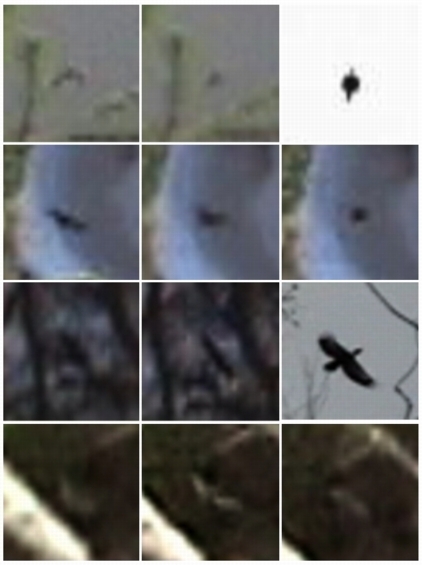Dienstag, 11. Oktober 2011
31. Als ob sie sich verlören, gäben sie ihn verloren.
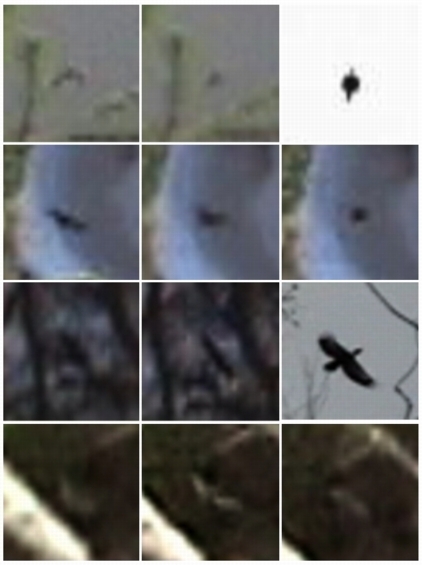
Manchmal wird einer müde. Lassen wir's, sagt er, es hat ja doch keinen Sinn. Wir haben alles versucht. Wir sind im Kayak durch Sümpfe gefahren, wir haben Steckbriefe verteilt, wir haben für verrottende Bäume gesorgt. Wir haben uns auf den Weg gemacht, als Katrina wieder weg war, der Sturm, wussten wir, war ein Geschenk für ihn. Wir haben jede Bewegung am Himmel fotografiert. Wir haben Kameraroboter aufgestellt. Wir haben sogar die NASA dazu gebracht, nach ihm zu suchen. Jedes Mal, wenn einer sagte, es ist vergebens, haben wir Fotos gezückt, auf denen etwas zu sehen war, dass entfernt aussah wie der, nach dem wir suchten. Wir präsentierten Tonbänder. Wir benannten sogar einen Hamburger nach ihm. Aber wenn es ihn wirklich gäbe, hätten wir ihn finden müssen. Wenigstens eine einzige Feder. Aber da war nichts, nie. Es gibt ihn nicht mehr.
Doch immer wenn einer müde ist, sagt ein anderer: Auf keinen Fall. Es muss ihn geben. Niemand kann beweisen, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich bin sicher, es gibt ihn noch.
[Solange sie nach dem Elfenbeinspecht suchen. Solange die Rasenmäher singen. Kann uns nichts passieren. Werden wir nicht frieren. Und alles wird gelingen.]
[Sufjan Stevens: The Lord God Bird (mp3) ]
30. Meine Frau. Das Arschloch.
Ich bin auf den Prenzlauer Berg gezogen. Die Wohnung war gut geschnitten und hatte eine große Küche, die Miete war auf den Quadratmeter umgelegt halb so hoch wie in München und um ein Drittel niedriger als in Hamburg. Eine Woche später fragte einer meiner neuen Kollegen (ich war für einen Arbeitsplatz nach Berlin gezogen), ob ich schon eine Wohnung hätte. Ich sagte ihm, wo. Er sagte: Das ist, wo ihr Arschlöcher alle wohnt.
So deutlich hat es nie wieder jemand gesagt. Dafür habe ich es ein paar Dutzend Mal gelesen. Menschen, die hier wohnen, gelten bei erstaunlich vielen anderen Menschen, die nicht hier wohnen, als so große Arschlöcher, dass die immer wieder darüber schreiben. Ich weiß es, weil ich den Tiraden gelegentlich hinterhergoogle.
Am schlimmsten für die Arschlochhasser sind die Prenzelbergmütter. Sie wissen nicht viel über sie. Sie reden nicht mit ihnen, erkundigen sich nicht nach ihren Leben. Eigentlich wissen sie bloß, dass die Prenzelbergmütter da sind. Auf der Straße, in den Supermärkten, in den Kaffeehäusern. Mit ihren Kinderwägen. Im Kaffeehaus sitzen sie am Nebentisch und packen ihre Euter aus. Im Supermarkt blockiert die Pbergmutter mit ihrem Kinderwagen die Gänge. Auf den Straßen fahren die Pbergmütter die Kinderlosen über den Haufen. Oder ihnen in die Hacken. Mindestens stehen sie im Weg. Man muss ihnen ausweichen. Viel mehr wissen die Arschlochhasser über die Pbergmutter nicht. Vielleicht noch, dass sie ständig Latte Macchiato trinkt. Ihr Kinderwagen ein Luxuskinderwagen ist. Und dass sie Kinderkult betreibt. Mit minimalen Variationen läuft es auf immer dasselbe hinaus: Dass hier Frauen mit Kinderwägen unterwegs sind. Sichtbar.
Die Frau, die ich liebe, mit der ich lebe und mit der ich ein Baby habe, ist so eine Prenzelbergmutter. Ein Arschloch. Sie hat es sich nicht ausgesucht. Die Adresse und das Kind, aber nicht, den Arschlochhassern Anstoß zu sein, aus dem einzigen Grund, dass sie sichtbar ist. Die Arschlochhasser können sie sehen. Wenn sie mit dem Kinderwagen unterwegs ist, mit dem Kind im Kaffeehaus sitzt, mit dem Kinderwagen einkaufen geht.
Sie tut niemandem etwas, sie ist bloß da. An denselben Orten, an denen sich die Arschlochhasser aufhalten. Sie bepöbelt keinen. Sie fährt niemandem in die Hacken. Sie drückt niemandem Kackwindeln in die Hand, keinem ihre Euter in den Blick. Schon weil sie keine Lust darauf hat, dass sich jemand, dem sie es nicht erlaubt hat, Gedanken über ihre Brüste macht. Dass sich jemand Gedanken über den Skandal ihrer Existenz macht, könnte sie nur vermeiden, wenn sie unsichtbar bliebe.
Vermutlich haben die Arschlochhasser nichts gegen die Frau, die ich liebe. Es ist nichts Persönliches. Das Problem der Arschlochhasser ist nicht die einzelne Arschlochprenzelbergmutter. Die verkraften sie. Sondern dass es so viele von ihnen gibt. Man kann nicht zehn Schritte laufen, ohne sie und ihre Luxuskinderwägen, schwarz wie Kindersärge, zu sehen.
Nachts hätten sie Ruhe. Nachts schlafen die Kinder ja, dann merkt man den Frauen nicht mehr an, ob sie Mütter sind. Das Pbergmütterproblem ist ein Tagsüberproblem, zwischen halb acht Uhr morgens und halb acht abends, im Sommer etwas länger. Danach könnten die Arschlochhasser aufatmen. Endlich freie Sicht. Doch das reicht den Arschlochhassern nicht. Der Tag sitzt ihnen in den Nerven. Die ganzen Mütter. Das schlaucht. Wenn es so weitergeht, muss man noch wegziehen. Obwohl. Wie kommen sie dazu? Wieso hauen nicht die Mütter ab? Oder bleiben zu Hause?
Es ist nichts Persönliches. Es geht darum, dass die Arschlochhasser hier einmal zu Hause waren. Oder zu Hause sein hätten können. Jetzt nicht mehr. Weil jetzt so viele Mütter hier sind, die alles majorisieren homogenisieren dominieren. Man fühlt sich wie ein Fremder. Als ob man nicht dazu gehörte. Wenn man kein Kind, keinen Kinderwagen, keinen Kinderwunsch hat. Bevor die Pbergmütter einzogen, war es besser. Es gab so viele Sorten Menschen hier. Alte, Alkis, alte Alkis. Arbeiter. Arbeitslose. Anarchisten. Assis. Und alles andere bis Z. Sogar Mütter. Aber nicht diese. Euter. Kinderwagen mit Kaffeehalter. Verstrahlte Blicke. Sie weichen nicht aus. Man muss um sie herumgehen. Sie besetzen alles. Sie nehmen den Arschlochhassern alles weg.
Die Arschlochkinderarschlochväter kommen in den Tiraden selten vor. Wenn einer mal sein Kind in der Manduca durch die Gegend schaukelt. Oder auf der Marie ins Handy redet, während sein Kind einem anderen die Schippe übern Kopf zieht. Oder am Samstag am Kollwitzmarkt im Weg steht, der Markt war übrigens auch mal anders.
Aber die Arschlochhasser gehen davon aus, dass es einen Arschlochkindarschlochvater gibt. Weil einer die Arschlochkindarschlochmutter finanzieren muss. Die Lilalämpchenwollseidegemischbodies. Die Rasselfischluxuskinderwagenkaffeehalter. Den Kinderkasten vor dem Fahrrad. Und einer muss die Fünfzehnseitenschriftsätze an die Hausverwaltung wegen Lärmbelästigung durch die Kinderlosen schreiben. Die Pbergmutter tut das ja nicht. Sie tut nichts. Außer sich um ihr Kind zu kümmern. Wenn man das mit Kümmern verwechseln will. Auf jeden Fall kümmert sie sich nicht um andere Menschen. Wenn ihr andere Menschen als ihr Kind am Herzen lägen, wäre sie weg. Dann wären die anderen Menschen endlich wieder froh.
Über die Pbergmutter wissen die Arschlochhasser so gut Bescheid wie Sarrazin über Türken, die Flotilla über Israel, die Nazis über die Bilderberger, der Koppverlag über den Fäkaliendschihad: allerbestens. Sie sind da, nicht wahr? Mehr muss man nicht wissen, um zu wissen: Sie müssen weg.
[Neulich schrieb mir über Facebook eine Anja Meier, die ich nicht kannte. Sie lese mit Vergnügen meine "Texte zu Elternschaft im urbanen Raum und in verschiedenen Lebensphasen" (als ob ich solche Texte je geschrieben hätte). Sie würde sich freuen, wenn "gerade" ich über Ihr Buch zu diesem Thema schriebe. Ich sah mir bei Amazon den Waschzettel an und schrieb zurück, ich sei skeptisch, wie jedes Mal, wenn ich Prenzelberg-Bashing und Mittelschichtmutter-Beschimpfe wittere. Weil es mir seltsam vorkommt, wenn ein Stadtteil ein Schurkenstaat sein soll und Mütter, die Gutes für ihre Kinder wollen, suspekt sind. Aber sie könne mir ihr Buch ruhig schicken lassen. Das hat sie letzte Woche veranlasst. Am Wochenende erschien in der taz ein Vorabdruck, die Pbergmütter werden darin Rinder genannt, ihre Brüste Euter. Nicht von Meier, sondern von einer Pberger Kaffeehausbesitzerin. Wenn sie ganz bei sich ist, lässt Meier gerne andere reden. Auch ihre Freundin Sibylle tobt in ihrem Buch viel rum über die Pbergmütter. Obwohl sie auch ihr nichts anderes getan haben, als zu existieren.
Meiers Geschichten, heißt es bei Amazon, seien "vor allem eines: erschreckend wahr, manchmal tragisch - und vor allem urkomisch."
Dass sie tragisch sind, ist nicht gelogen.]
Montag, 10. Oktober 2011
29. Buch, Telefon, Schallplatte, Schrift, Kamera.
Wie wir bei Korb standen. Ich & alle, die ich hätte werden können. Eine halbe Stunde kalkulierten. Weil es ja nur für ein einziges Suhrkampbuch reichte. Keinen Plan. Es gab ja keinen. Von dem man ihn bekommen hätte können. Keinen der was sagte. 1974 war noch so stumm. Im Unterschied zu heute 15 sein. Wen konntest du fragen. Wer hätte dir was gesagt. Wer hätte dich erraten. Wolltest du gar nicht. Das war das Beste. Nicht erraten zu werden. Endlich nicht. Was machst du da? Warum schaust du so? Schau nicht so. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Schau nicht so frech. Das ging Jahre. Dass du erraten werden solltest. Immer falsch. Immer total falsch.
Als das Wünschen noch geholfen hat. Hat es aber nicht. Mir und allen, die ich hätte werden können. Wenn es geklappt hätte. Hat es ja nicht. Zu beschäftigt mit aussterbenden Aufzeichnungstechnologien. Tipptoppnarkosen. Damit du was hattest. Ein Suhrkampbuch, in das du schauen konntest. Damit du nicht erraten wurdest. Dann ging es wieder. Dann war es. Als hättest du einen Plan. Durch den du (und alle, die du hättest werden können) so unverwundbar wurdest. In diesen Momenten. Die du nicht einmal verstanden hast. Das Suhrkampbuch. Immer dabei. Mit den Fotos von La Defénse. Und all so was. Dann ging es wieder. Kam dir niemand nach. In deiner Tasche. Bei dem ganzen Schulscheiß. Dieses eine Ding. Gegen das Unwohlsein. Was für ein Elend.
Die Telefonate. Bei denen du immer erst fragen musstet. Kann ich sie sprechen. Ist sie zu Hause. Kann ich sie bitte sprechen. Und nach denen sie gefragt wurde. Wer war das. Was wollte der. So wie du gefragt wurdest. Wen rufst du an. Aber nur kurz. Und an der Stille merktest, dass du belauscht wurdest. Deswegen nicht wirklich reden konntest, Während du da stehen musstest. Es ging ja nur im Stehen. Vor dir die Tapete. Und im Raum zwei Ohren, die alles mithören konnten. Wusstest du nicht. Konntest es auch lassen. Unter diesen Umständen. Dieses Stummsein. Weil du nicht erraten werden wolltest. Unter keinen Umständen. Nur das Notwendigste. In diesem Ton. An dem du nicht erraten werden konntest. Können wir uns sehen. Um vier. Im Landgraf. Im Traxelmeyer. Wie immer. Damit man nichts wusste. Weil sie das Recht hatten, alles zu wissen. Und dann war besetzt. Und du musstest es noch einmal probieren. Dieselbe Konstellation. Wieder da stehen, die Tapete anstarren, reden, als redete man gar nicht. Oder bei dir besetzt war. Ewig. Weil irgendjemand im Haus telefonierte. Viertelanschluss. So dass man nicht reden konnte. Weil der Nachbar redete. Bis es knackte. Und man wusste, jetzt geht es. Kann ich sie sprechen. Ist gerade weggegangen. Vor fünf Minuten.
Wie du ewig kalkuliert hast. 140 Schilling. Für 35, 40 Minuten Abgehen. Ewig gestanden hast in diesem Laden. In diesen Läden später. Keine Ahnung mehr, wie die hießen. Es gab immer diesen einen, der angestelllt worden war für deinesgleichen. Damit du ( & alle die ihr werden hättet können) wiederkamen. Hatte nichts dagegen, dass du dir sieben, acht Platten auflegen ließest. Unter diesen Kopfhörern hörtest. Neben dir vier fünf andere wie du. Lauter Jungs. Ernsthafte junge Männer. Mit ernsthaften Gesichtern. Manche die Augen geschlossen. Wenn sie eine ganze Seite durchhörten. Und dann wieder gingen. Ohne was zu kaufen. In manchen Läden ging das. Ohne dass er murrte. Der für dich angestellt worden war. Der Drop-Out. Schallplattenverkäufer. Nicht viel älter als du. Vier, fünf Jahre. Längere Haare als du. Aber immer noch gepflegt. Hier. Hör dir die an. Wenn du die magst. Musst du die anhören. Und? Super. Was der jetzt wohl macht. Müsste Mitte fünfzig Anfang sechzig sein. Immer noch Linz. Oder Pasching. In der Gartenstadt. Die Eela Craig, die du dann kauftest. Wegen des Konzertes. In der Arbeiterkammer. Lokalhelden. Dass es so was in Linz gab. Mit Mellotron. Zehnminutenstücke. Drifteten dann ab. Ins Religiöse. Computermessen. Bombast. Aber die erste. Hattest du. Dieses ganze Progzeug. Magma. Saucerful of Secrets. Ash Ra Tempel. Amon Düül. Court of the Crimson King. Die Zeit ehe Punk kam. Ernsthafte junge Männer. Was für ein Elend.
Die Hefte, in die du geschrieben hast. Din A 5, unliniert, oranger Einband. Schulhefte. Texte. Als ob sie dich unverwundbar machen konnten. In winziger Handschrift. Immer bis zum Rand. Wo die abgeblieben sind. Irgendwann der Scham zum Opfer gefallen. Kannst du nicht mehr überprüfen. Dass man gedruckt werden konnte. Die größte Vorstellung die es gab. Wenn man keinen Plattenvertrag anstrebte. War es das Gedrucktwerden. Blocksatz. Statt Handschrift. Das Buch das heilige Buch. Wie dir die Leute vorkamen die Bücher hatten. Anselm. Bäcker. Unvorstellbar dahin zu kommen. Wie alle schrieben. In ihre Hefte. Rudi. Der plötzlich aufgetaucht war. Wie eigentlich. War plötzlich da. Vom Land nach Linz verschlagen. Die Landkinder damals. In die Stadt geschickt. Zum Lernen Hackeln. Keine Ahnung was der eigentlich machte. Ob der ein Fahrschüler war. Oder ein Lehrling. Schrieb die ganze Zeit. Am allermeisten von uns allen. In einer Sauklaue. Las das vor. Kämpfte sich durch seine eigenen Texte. Neulich auf Facebook wiedergefunden. Ob ich sein Facebookfreund. Hat jetzt zwei Söhne. Und ein Weblog. In dem er bloß Bibelsprüche postet. Und Moses sprach. Der Herr der Heiland. Wie dieser Typ der mich zum Maturatreffen. Ich im Taxi. Berlinnale oder so was. Und er den ganzen Weg nur Jesus. Ob ich es je versucht hätte. Bin doch Kommunist. Jesus auch. Hat keinen Sinn. Das kannst du nicht wissen. Doch. Versuch es doch. Gab nicht auf, bis ich auflegte. So seltsam. Konnte mich kaum an den erinnern. Und gab mich weniger auf als ich mich selbst. Und alle die ich hätte werden können.
Wie nie jemand Fotos machte. Von dir. Weil niemand eine Kamera hatte. Nur Eltern. Nur in den Urlauben. Aber nie. Auf dem Schlossberg im Speedy im Badcafé in der Arbeiterkammer. Dass du nicht weißt wie das aussah. Und du. Und sie und sie und sie. Wie schwer es war. Ein Foto zu bekommen. Auf dem sie und sie und sie war. Dass du dann gehabt hättest. Und hättest ansehen können. Und ins Suhrkampbuch legen hättest können. Für dich. Gab es nicht. Auch nicht dieses Wissen. Dass du auf Bildern landen konntest. Vielleicht warst du gar nicht wirklich da. Nur provisorisch.
Sonntag, 9. Oktober 2011
28. Am schlimmsten.
Am schlimmsten sind die Beinahe-Unfälle. Du drehst dich um, um ihr einen Apfel zu schneiden, als du wieder zu ihr schaust, ist sie halb aus dem Hochstuhl, eine Zehntelsekunde später wäre sie gefallen, Kopf voran. Du stehst an der Kreuzung, alles ist gut, dann rast ein Radfahrer vorbei, Renngeschwindigkeit, einen Zentimeter am Baby vorbei. Arschloch, brülle ich, er hört es nicht, die iPodstöpsel. All die Augenblicke, in denen man sieht, wie eine Kante, eine Ecke, eine Spitze und ihr Körper sich aufeinander zubewegen und dann gerade noch doch nicht, aber nicht immer, weil man sie noch abfängt. Du merkst, wie unsicher Wohnungen sind für Menschen mit 70 Zentimetern, wie viele Steckdosen du verkleiden musst, hast du wirklich alle, und natürlich protestiert sie, weil sie sich in die gesicherten Steckdosen hineinpulen will und du der Kindersicherung doch nicht traust. Sie schafft es, so schnell auf den Sofaabgrund zuzukrabbeln, dass du dich manchmal im allerletzten Moment dazwischenwerfen kannst, verrückt, das sich Höhenangst erst entwickeln muss. Sie könnte losspringen, zur heißen Backrohrtüre hin. Hunde könnten losspringen. Klemm dir bloß die Finger nicht ein.
Mittwoch, 5. Oktober 2011
27. Kostenkontrolle.
I got a small but revealing personal glimpse into this issue today, when the reimbursement form for my recent trip to Berlin arrived by email. The conference I attended was partly supported by Germany's Nationale Akademie der Wissenschaften (National Academy of Sciences), which means that travel expenses must conform to the Bundesreisekostengesetz ("German Federal Travel Expenses Act"). The best part of the reimbursement process is the special form for taxi fare, which states "Costs for taxi rides are only reimbursable under exceptional circumstances such as urgent official activities or compelling private reasons." Specifically, travelers will be reimbursed for taxi fare only if: 1) "necessary official and personal baggage weighs more than 25 kg"; 2) there is no public means of transport and the destination is beyond walking distance (defined as 2 kilometers); 3) the wait time for public transport exceeds one hour; 4) health reasons; or 5) they are traveling between 11 PM and 6 AM. Note: the form also reminds you that "bad weather" or "lack of knowledge of a place" are not considered "exceptional circumstances."
Foreign Policy > Stephen M. Walt: My contribution to solving the Euro crisis
["Ortsunkundigkeit und widrige Witterungsverhältnisse sind keine triftigen Gründe." (Q]
Sonntag, 2. Oktober 2011
26. King Kong.

Wenn einer käme, um mich hochzuheben, umzudrehen, kopfüber zu halten wie ich sie, müsste er 5,40 groß sein, habe ich mir ausgerechnet.
25. Rettungsschirm.
Dieser Loop gerade, der immer wieder anfängt, von der Ohnmacht der Staaten, des Staates zu reden. Gegenüber dem Finanzkapital, dem Casino-Kapitalismus, den Banken, den Zockerbuden (persönliche Erklärung irgendeiner fuchtelnden Abgeordneten der Linken zwischen Stimmkarteneinwurf und Stimmkartenauszählung). Das Narrativ des verzweifelten Widerstandes des Staates gegen den Angriff der Finanzmärkte. Damit auch du keine Klassen mehr kennst, nur noch Staaten. Damit auch dir das Staatswohl am Herzen liegt, hast lange geschwänzt, während der Staat, der Sozialarbeiter, sich gekümmert hat. Als ob's nicht die Staaten wären, die jetzt die Grausamkeiten begehen, als ob ihnen bei den Grausamkeiten jemand in den Arm fallen könnte.
24. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe.

Heute vor sechs Monaten starb Marc Fischer.
Samstag, 1. Oktober 2011
23. The sheer ecstasy of being a lunatic father.
Mein schönes Kind, es wühlt sich hinein in mich und windet sich und schreit die Luft an, und dann schläft es doch. Es ist eine Willmaschine, will das iPad haben und meine Hand aufessen und heult mich an, wenn meine Hand nicht will. Es will mich in die Nase beißen und in die Augen stechen und Karottenbrei und Weißwurst, kommt alles wieder raus. Mein Kind wächst jeden Tag, bald ist es zweieinhalb Meter lang, aber jetzt ist es noch ein Zwerg. Mein schönes Kind schaut mir tief in die Augen und dann kackt sie los, wann hast du das je, dass eine dir tief in die Augen schaut und dabei kackt, da kommen sicher noch Sitten rein stattdessen. Mein schönes Kind streckt die Zunge raus, wenn es sich konzentriert, es ist eine schöne kleine schnelle Kolibrizunge, die Sabberfäden zieht, und leckt ganz schnell alles rein, alles meins. Sie verschlingt Papier, verschlingt Wollmäuse, verschlingt Flusen, dann guck ich in ihren Mund und pule es wieder raus, ich bin der Filter für ihren Mund, das kann rein und das lieber nicht. Meinem schönen Kind gehört alles unter einem Meter Höhe, hat keinen Sinn, zu hoffen, sie kriegt es nicht. Sie kriegt es doch. Sie hat den Musil, den Kluge, den Frisch, den Gadda, den Hölderlin, den Proust aus dem Regal gezogen, sie sitzt in Prousthaufen und lacht sich schlapp, sie reißt sich Musilseiten raus und steckt sie in den Mund, ach Fännfänn, sag ich, das schmeckt doch nicht. Mein schönes Kind ist ein Mädchen, was ist es denn, wollen die Leute wissen, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, ein Mädchen sagen wir, als ob daraus etwas folgen würde. Sagen sie eher SÜSS, wenn es ein Mädchen ist? Sagen sie eher TOLL, GROSS, STARK, WEIT, wenn es ein Junge ist? Die Wahrnehmungs-Werkseinstellung lautet immer noch: Junge, ER-Pronomen, wie heißt er denn?, nie: wie heißt sie denn? Mein schönes Kind rollt sich, dass ich sage: du Rollmops, es windet sich, dass ich sage: du Schlange, es grunzt beim Speed-Krabbeln, weil es sich so freut, dass ich sag: du Ferkel. Wo kommen die Tiere alle her, warum schenke ich ihm lauter Tiere, das Krokodil, den Fisch, den Affen, die Bobobücher mit der Fuchsfamilie, das iPad-Wimmelbuch mit dem Pupsschwein, dem Salatklaureh, den Elefanten? Die Liebe zu einem Kind ist, dass du ihm Tiere gibst, als dächtest du: das sind seine Freunde. Und wann gewöhnst du dir das wieder ab, sind die die Tiere wieder nur etwas, in dessen totes Fleisch du deine Zähne schlägst? Mein schönes Kind ist ein Quengel, ein Schrei, ein Wimmer, ein Dadada und Gagaga, wie lieb ich das. Es spuckt mir auf das T-Shirt langt mir an den Mund zerrt an meiner Lippe schnappt sich meine Brille stochert mir ins Auge patscht mir in mein Essen patscht trommelt auf meiner Brust. Mein schönes Kind macht mir ein schwarzes Herz, ich mag’s nicht leiden, dass es groß wird, es hat schon eine Steuernummer und einen Reisepass mit Passfoto und eine IDENTITÄT und eine STAATSANGEHÖRIGKEIT und ein Aktenzeichen und einen Kita-Gitschein und eine Biometrie, das lassen sie sich doch nicht nehmen, da langen sie gleich zu, das ist eben so, und ich kann nichts machen dagegen, aber jetzt ist noch gut. KRAPPKRAPP sag ich, KRAPPKRAPP.
Mittwoch, 28. September 2011
22. Bandiera hossa.

Immer alberner am Gegenwartskapitalismus: sein Drang, zu werden wie die ehemals kommunistischen Staaten, die er durch Kreditvergabe und Wettrüsten befreit hat. Es gibt Geld, aber nur die Nomenklatura kann was kaufen. Facebook sammelt die privaten Leben ein (20:03 Treffen mit Dingsbums, Dangsbems und Dungsbims, 00:03 Konsum von Westfernsehen, immerhin abfällige Bemerkungen) und erklärt sie für sein eigenes Eigentum. Alles, alles, alles geht ins Überleben des Staates. Ständig werden einem die Ziele des III. Rettungsprogramms in die Gehirne gedrückt, Wirgefühle beschworen, die historischen Notwendigkeiten behechelt, alle gesellschaftlichen Kampf- und Massenorganisationen machen mit, irgendwann werden die Leute Gras fressen, aber die Führer führen uns einer lichtvollen Zukunft entgegen, wirst sehen, nach dieser Übergangsphase gehts wieder aufwärts.
[Für den Kommunismus habe ich mich lange aus einem Grund interessiert, den mir keiner glauben wird: Er war für mich eine Bewegung (theoretisch, eh klar, die wirklichen Kommunisten, die ich kannte, waren meistens Dolme, die ihre eigene Sache nie kapiert haben), die wusste, dass man die Produktion vernünftig vergesellschaften muss (die Nowendigkeit, den Hunger, die Industrie etc.), damit man endlich von der Gesellschaft in Ruhe gelassen wird. Nichts ist ja so zäh und trostlos wie der soziale Verkehr. Gut reden, leben usw. schafft man mit vier, zehn, zwanzig, vielleicht noch mit fünfzig Leuten, aber danach ist es unskalierbar. Immer, wenn ich Marx gelesen hattee, dachte ich: hey, da will einer die Gesellschaft loswerden, da bin ich dabei. Man macht sich aus, was man zum guten Leben braucht, rechnet aus, wie viel Arbeit und Gesellschaftlichkeit man dafür aufwenden muss, teilt die Arbeit so auf, dass jeder sich so wenig wie möglich aufreiben muss, dann arbeitet man zwei Stunden am Tag, oder einen Tag in der Woche für die Mehrung des Gebrauchswertreichtums der Gesellschaft, den Rest der Zeit hat man Ruhe und wird nicht belagert von Gemeinschaftsappellen, Stimmungsdirektiven und was es nicht alles gibt. ¶ Nicht, dass mir das Aparte an meinem Gedenke nicht selbst öfter mal peinlich vorkommt.]