Vereinzelungsanlage.
Whatever happened to Queer Happiness?: Ein Essay von Kevin Brazil in Granta Juni 2020, im Herbst 2022 erscheint bei Influx Press ein Band mit demselben Titel.
Gute Frage, dachte ich.
Als ob ich die leiseste Ahnung hätte, was Queer Happiness ist. Und wo sie abgeblieben ist.
Manche meiner Urteile belasten sich nicht mit Erfahrungswissen. Zu ihnen gehört auch, dass Queersein anstrengend ist. Etwas Kompliziertes, bei dem es viel um Identität geht, um Erkannt- und Angenommenwerden, um Verletzungen und den Widerstand gegen die Menschen und Umstände, die sie einem zufügen. Eher selten um Happiness.
Vermutlich liegt das daran, dass mir Queerness nur durch Diskursmühlen gedreht begegnet. Ausufernde Twitterthreads, Taxonomien, Pronomen, Definitionen, umständliche Sätze, Semantikschlachten. Als säße man am Rande eines Spielfelds, auf dem Leute gegeneinander anrennen, und man hat keine Ahnung, worum es eigentlich geht.
Wenn ich dabei zu lange zusehe, werde ich mürbe. Und vergesse, dass queere Menschen – wie andere auch – sicher nicht ununterbrochen darüber nachdenken, was und wer sie sind, ob man sie richtig, falsch, genügend wahrnimmt. Sondern dass sie essen, trinken, feiern, Sex haben, schwimmen, rausgehen, weil draußen die Sonne scheint.
Kevin Brazil allerdings hat denselben Eindruck wie ich, obwohl ihm anders als mir die Empirie nicht fehlt. Er hat ihn aus ähnlichen Gründen: In dem, was und wie medial über Queerness erzählt wird, ist Happiness ausgelöscht.
„That to be gay is to be defined by suffering is the premise of the baroque symphony of trauma that is Hanya Yanigahara’s A Little Life (2015) as much as the solo recital of shame that is Garth Greenwell’s What Belongs to You (2016). To be gay is to be suffer among Puerto Rican New York in Justin Torres’s We the Animals (2011), among the Vietnamese-Americans of Ocean Vuong’s On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019), among affluent Nigerians in Uzodinma Iweala’s Speak No Evil (2018) and in Communist Poland in Tomasz Jedrowski’s Swimming in the Dark (2020).“Es geht nicht nur um schwule Männer und nicht nur um Romane, so verhält es sich auch in „Alison Bechdel's memoir Fun Home (2006), In the Dream House (2019) by Carmen Maria Machado, Difficult Women (2017) by Roxane Gay, The Lonely City (2016) by Olivia Laing“. – Überall: „Queerness produces isolation“.
An dieser Stelle könnte Brazils Essay über die thematischen Verengungen, die er beobachtet, herummuffen, sich darüber beschweren, wie viel Leiden und wie wenig Happiness es in queeren Romanen gibt. Von denen könnte man schließlich erwarten, dass sich in ihnen queere Identität nicht so anhört, als wäre sie eine Bürde.
Das macht Brazil aber nicht – auch wenn ihn das Unhappiness-Klima in queeren Romanen zu nerven scheint. Stattdessen geht er einem abgründigeren Gedanken nach: Möglicherweise liegt es an den Spielregeln und Konventionen, die für autobiografische Texte gelten, dass in ihnen queere Menschen so leidend wirken.
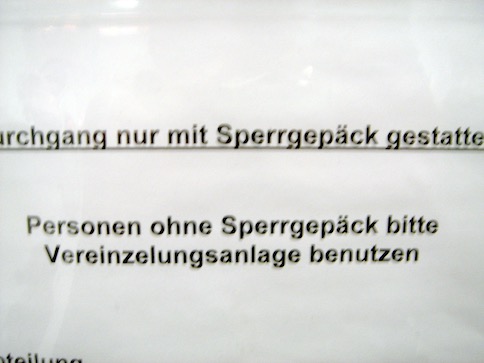
Der Grund für das Fehlen von Happiness
„lies less in their queer content, but in their autobiographical form. (...) Autobiography isn’t wedded to unhappiness, but it has been having affairs with misery ever since Augustine’s Confessions. (...) The fate of queer writing that touches on autobiography has been to be forced, by reasons of the form and the world in which it is written, into the confession of unhappiness. (...) Autobiographical writing is a way to cope with suffering by creating, in writing, a self that has survived. But that self is created only insofar as it has suffered. (...) Stories that individualise by detailing unhappiness, have the power of a certain kind of resistance, but it’s a resistance built into the structure of domination itself. That’s why after a while all the stories of queer suffering strangely start to sound the same, as if beneath a thousand melodic variations you realise they have all been written in the same key. These stories are not nearly as individualizing as they claim to be, because they all purchase their individuality by the scale of their suffering.“
Das alles habe queeres autobiografisches Schreiben übrigens mit dem von cis-Autoren gemein:
„There is nothing in terms of literary form that the Chris Kraus’s of the world are doing that wasn’t done as early as the 1960s by those nadirs of male heterosexuality John Updike, Philip Roth, and Norman ‘fugging’ Mailer.“
Stimmt, dachte ich. Gleich danach fielen mir Knausgård und Carrère ein, die beiden Autofiktions-Champions, die ich in den letzten Jahren manisch gelesen habe. Bis sie mir auf die Nerven zu gehen begannen. Weil sie mir nur noch wie One-Trick-Ponys vorkamen – zwei Schmerzensmänner, die ständig an den Gitterstäben ihrer Identität rütteln. Nach vielen hundert Seiten möchte man erschöpft in Deckung gehen und ihnen Lebensratschläge zukommen lassen. Geht doch mal raus. Wenn es so krass ist, Knausgård oder Carrère zu sein, könntet ihr doch damit aufhören, Knausgård und Carrère zu sein. Undsoweiter.
(Wahrscheinlich empfinden Therapeuten bei manchen ihrer Klienten ähnlich: Lass doch mal gut sein, das gibt’s doch nicht, dass du immer noch dieselben Geschichten erzählst.)
(Das Angepisstsein von Carrères Exfrau von Yoga. Weil er darin seine Leidenskünstlershow aufführt. Und dabei so und so oft nicht die Wahrheit sagt.)
Aber selbstverständlich habe ich mich bei diesen beiden nie gefragt: Whatever Happened to Male Heterosexual Happiness? Schon, weil ich aus meinem eigenen Leben weiß, dass es sich nicht in den Autofiktionen erschöpft, in denen es sich auslegt.
Andererseits: Whatever Happened to Male Heterosexual Happiness?
Fragen wird man ja dürfen.
Abschweifung, geh weg.
Vielleicht, sagt Brazil,
„it isn’t possible to write about happiness at all. ‘Le bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches,’ wrote Henri de Montherlant. ‘Happiness writes in white ink on a white page’. Happiness leaves no trace on a state of blankness, and it is happiness because it leaves no trace. In moments of happiness, we are not recording, we are not transcribing. We have not split our self between past and future, the split that takes place with every act of writing.“
Wer Autofiktion schreibt, ist in eine Falle gegangen – sie zwingt dazu, Unhappiness zu schreiben und Happiness zu streichen. Es müsste so nicht sein. Aber es ist so. Die Konventionen des Schreibens. Die Formen des Redens über Identitätsfindung. Die Zwänge des Marktes. Die Lesererwartungen. Tolstoj, der gesagt hat, alle glücklichen Familien seien gleich. Autobiografie als Werkzeug der Individuation, Individuation als Weg der Unglücksbewältigung. Horkheimer, dessen Psychoanalyse bei Kurt Landauer von diesem abgebrochen wird: „Wir können nicht weitermachen, Sie sind zu glücklich, es geht Ihnen zu gut. Um wirklich erfolgreich die Analyse fortzusetzen, müßten Sie nach Berlin gehen, damit Sie nicht immer bei Ihrer Frau sind; das macht Sie zu glücklich.“
Könnte sein, dass man über Happiness anders sprechen, dass sie sich anders ausdrücken muss als durch Autofiktion.
Brazil selbst zückt in seinem Text strategisch ein paar Erinnerungslisten und Erinnerungsbilder. Namen von Clubs, in denen er glücklich war, Sängerinnen, Dinge, die er wohl bei anderen sexy findet („Biker boots, armband tattoos, scars on show at the pool“ usw.). Einmal, erzählt er, war er bei einem Rave von „women, womxn, and those who reject such categories as tools of oppression“, musste länger als seine Freunde warten, bis er eingelassen wurde, war drinnen der einzige sichtbare Mann unter lauter Fremden,
„and gradually, without noticing it at first, we all began to move in loose unison: legs whipping out and bodies jacking back, over and over again. No one paid any attention to me, I played no part in the currents of desire that were swirling all around me, but my body, and its difference, for how long I can’t remember, were invited to belong.“Ein anderes Mal, erzählt er, war er in Manchester bei einer Party, und
„sometime in the afternoon my friend took me into a room where the only person who wasn’t a bearded gay man was a girl leaning against the wall, wearing a necklace which said TECHNOFEMINISM, who barely danced but just smiled. Soon a woman’s voice was singing a chorus over and over again, and everyone joined in, and it was played on loop for so long that I learned the words and joined in, singing with hundreds of the hardest-looking men preening and weeping as if centre on the stages of a hundred little operas. I didn’t know the song, I didn’t need to know the song to become just another diva in the crowd performing for an audience of one.“
Es sind schöne Bilder. Alle haben sie etwas mit einem Lockerlassenkönnen des Ichs in Gruppen zu tun, in denen man sein kann, wie man ist, die einem nichts abverlangen und einen zu nichts zwingen. „Is this what it means to be happy? In those clubs, the working of desires and embodiments that I will never experience produced those moments where I felt suspended in that strange place between individuality and the collective, neither one nor the other, neither different nor the same, certain these were not my experiences alone, certain I was not writing the story that is ‘me’.“
Happiness, dahin steuert Brazils Essay schließlich, hat oft mit einer bestimmten Art des Zusammenseins mit anderen zu tun, mit Freundschaften, die wie ein Netzwerk funktionieren (es gibt in seinem Text eine schöne Passage über seine Verwunderung darüber, dass friendship in queeren Romanen weniger wichtig zu sein scheint als im queeren Leben).
„The queer theorist Sam McBean instead likens these bonds of friendships to a ‘network’. You care and are cared for, sustain and are sustained, not within the imaginative horizons of Mommy, Daddy, and Me, but within a web that includes you yet extends beyond you. Sustaining these bonds takes work, and this work returns to you in time, but not always as the balancing of debit and credit that takes place between two people. You might not get what you need from the person to which you give, but it will come back from another who is given and getting from others in turn.“
Und:
„Our boundaries dissolve, we lose ourselves in another, we return to the undifferentiated belonging we experienced in the womb. A network, however – whether we picture that as computers linking up to create the internet, or as the fish, corals and luminous algae that make up an underwater reef – is by definition made up of more than two. Its members neither dissolve into the ocean, nor remain isolated individuals in their shells. They are suspended between being a part and a whole, between being an individual and collective.“
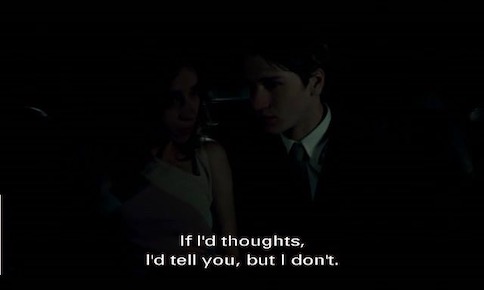
Wo das noch hinläuft? Wird man sehen. Bei Brazil auf eine Rehabilitation, Feier, Beschwörung der kollektiven Freude, nehme ich an. Bei einem male heterosexual irgendwas: weiß ich auch nicht. Erst einmal auf die Frage, wie Texte sein könnten, die Glück nicht nur behaupten (das ist öde), sondern es schreiben, wie man im Schreiben die Vereinzelungsanlagen-Falle, die das Schreiben oft ist, austricksen kann. Lyrik vielleicht. Hubert Fichte vielleicht. Dissoziation statt Konzentration vielleicht. Wer weiß das schon.