Disclaimer.
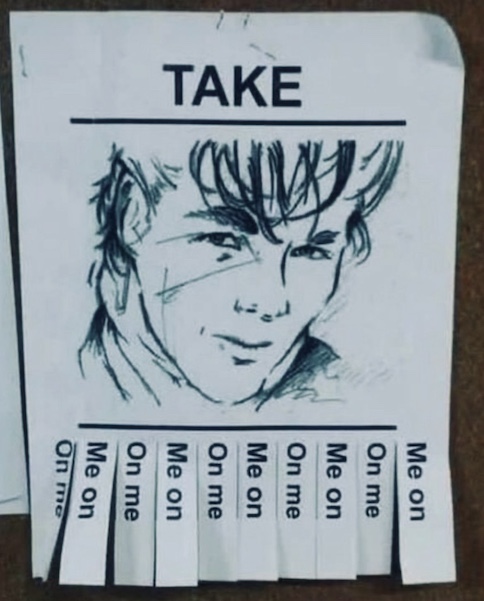
Vor über zwanzig Jahren habe ich zum ersten Mal damit angefangen, ein Weblog zu schreiben. Stefan hatte uns eines zugelegt, schau mal, mailte er, vielleicht ist das etwas für dich. Also schrieb ich, am 30. Oktober 2001, ohne irgendeinen Plan, worauf das hinauslaufen sollte, zwei kleine Texte:
1. Zwei Sorten Städte
In den einen ist man von Anfang an. In den anderen kommt man nie an. Tokyo: hat nie angefangen, nie aufgehört. Ich weiß gar nicht, wo Tokyo war, oder was, oder wann. Schoss bloß im Kopf zu einer Stadt zusammen. Diese windschiefen Holzställe neben den Stadtautobahnen. Die Hochhäuser in der Entfernung. Kamen nicht näher. Ich auch nicht. Bis ich wieder weg war.
2. 15 Sekunden.
Was für ein Glücksgefühl das war. Eine neue Platte aus der Hülle nehmen. Nur mit den Fingerspitzen anfassen. Jedenfalls bei den ersten paar Malen. Später wurde man nachlässiger. Auflegen. Den Staub vom Saphir pusten. Normalerweise müsste man jetzt den Tonarmhochhebhebel betätigen. Aber so lange kann man nicht warten. Man legt händisch auf. Wird schon nichts schiefgehen. Oder doch. Aber das hört man erst nach zwanzigmal, und vielleicht mag man dann die Platte eh nicht mehr. Wenn man sie mag, ist es einem egal, dass es knackt und knarzt. das erste Stück ist meistens sowieso nicht das beste. Die besseren Stücke haben sie sich früher immer aufgehoben. Wenn bei den CDs dagegen nur ein Stück gut ist, ist es das erste. Weil es bei den meisten CDs, die gemacht werden, auf die ersten 15 Sekunden ankommt. Die Plattenfirmen schicken einem das genauso. Mit einem Begleitbrief, in dem es heißt: Anspieltip - track one. Sie wissen genau, dass wir wissen, dass es Schund ist, dass wir höchstens 15 Sekunden zuhören werden, und wenn es dann nicht rockt, wird die CD nie wieder einen Abtastlaser fühlen. Deswegen ist es das erste Stück. Deswegen sind es die ersten 15 Sekunden des ersten Stückes. Deswegen muss für die ersten 15 Sekunden des ersten Stückes ein Produzent her, der früher geniale Loops gemacht hat. Da hat die Plattenindustrie eine geringe Chance, dass man dem beschissenen Rest doch noch zuhört. Es muss mit einem Effekt losgehen.
Seltsam, denke ich beim Wiederlesen: Das sind zwei Texte, die vom Anfangen handeln, davon, wie etwas – eine Stadt, Musik - losgeht, und davon, wie Leute, die einem etwas verkaufen wollen, versuchen, Anfänge als Versprechen zu designen, damit man bleibt statt gleich wieder anderswohin zu verschwinden. Damals ist mir das nicht aufgefallen.
Damals habe ich einfach immer nur weitergeschrieben. An diesem Endlostext, von dem es hieß, er sei ein Weblog, es dauerte noch, bis Leute es auf Blog verkürzten und es das Verb bloggen gab. Niemand wusste wirklich, was Weblogs waren, werden konnten und würden, worauf sie hinausliefen, wozu sie gut waren, was man mit ihnen anstellen konnte. Weblogs waren damals noch völlig anders als jetzt: Zum Beispiel gab es für Amateure wie mich, die sich nicht selbst etwas programmieren können, noch lange keine Kommentarfunktion. Wenn eine Leserin (ich gendere nicht, aber an den Stellen, an denen ich es könnte, meine ich immer m/w/d) etwas zu dem sagen wollte, was ich geschrieben hatte, musste sie eine Mail schreiben, dann bekam es aber nur ich mit, oder etwas in ihr eigenes Weblog schreiben und einen Link zu dem Text setzen, den sie kommentierte. Das taten gar nicht einmal wenige. Eine Zeitlang, so kam es mir vor, wuchsen Weblogs wie eine Sommerblumenwiese, plötzlich explodierten Farben.
Für mich, der ich zufällig zu einem Weblog gekommen war, war es großartig, etwas völlig Neues. Ich schrieb, was ich wollte, in der Länge und in der Form, die mir einfielen, ich konnte es sofort ins Netz stellen, an einem Ort, den ich mir selbst so eingerichtet hatte, wie ich wollte (ich war nicht so besonders begabt, was Design betrifft, aber ich schaffte es, Texte einigermaßen augen- und lesereundlich zu präsentieren). Und ich schrieb zwar für andere Menschen (statt nur für mich selbst), aber ich kannte sie nicht, wusste nicht, ob ich und von wie vielen ich gelesen wurde, wie sehr sie es mochten oder hassten, man wurde nicht, wie später, beobachtet, bewertet, kommentiert usw., aber manchmal bekam man eine Mail, manchmal machte sich jemand die Mühe, auf seinem eigenen Weblog auf einen einzugehen. Es gab noch keine Weblogerfolgsformeln. Es zwar Leute, die, wie oft in dergleichen Fällen, entweder eine Medienrevolution oder viel Kohle oder beides witterten, aber es gab noch sehr viel mehr, die Weblogs nicht für das neue große Ding hielten.
Deswegen hatte man jede Freiheit, zu tun, was einem einfiel. Selbstverständlich hat man sie noch immer. Aber in einer durchmedialisierten Umgebung, in der „Weblog“ etwas sehr viel anderes bedeutet als vor 20 Jahren, fällt einem vielleicht nicht auf, dass und wie viele Freiheiten man hat.
Mir sind beim Nachdenken darüber, was ich da eigentlich tat und warum es mich so zufrieden machte, damals immer mal wieder Vergleiche eingefallen, die etwas mit Musik zu tun hatten und nichts mit Settings, in denen geschrieben wird. Dass Weblogs so etwas wie Jam Sessions seien, dachte ich: Irgendjemand stellt sich hin, schnappt sich ein Instrument und legt los, andere kommen vorbei, hören zu, spielen mit. Oder dass die frühen Weblogs wie früher Punk waren, go for it, kleine finnische Clubs, es ist wichtig, dass du dich ausdrückst. Es war eine großartige Zeit für mich. Nicht nur hatte ich einen Ort gefunden, an dem ich auf andere Weise schreiben als in meiner Arbeit und dabei etwas über das Schreiben und mich herausfinden konnte. Sondern, und oft wog das schwerer, es gab viele, die das auch taten, auf ihre Weisen, ein riesige Jam Session, und das Schönste war, dass Virtuosen und Krachmacher zusammenspielen konnten.
Ich habe keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Wahrscheinlich. Irgendwo anders und nicht mehr so, wie es war, sondern auf ganz andere Weise, aber die Bedürfnisse und die Elektrisiertheit und die Glücksberauschtheit, wenn man durch ein Medium an einen Ort kommt, an dem es einem richtiger geht, sind ja nicht verschwunden.
Ich habe aber eine Ahnung, was mit mir geschehen ist. Nach vielen Jahren, in denen ich fast täglich an diesem Weblog weitergeschrieben hatte (es war umgezogen, es hatte sich Kommentare zugelegt ...), habe ich damit aufgehört. Das hatte nichts damit zu tun, dass das Weblog aufgehört hatte, gut für mich zu sein. Sondern mit den Umständen in meinem Leben. Für mein Weblog nämlich hatte ich mir vorgenommen, mich nicht so weit von meinem Leben zu entfernen, wie es beispielsweise die journalistischen Texte erzwingen, die ich schreibe, ich wollte mich nicht ausstreichen, ich wollte einigermaßen an mir bleiben, Autofiktion, ich sagen, versuchen, wie man sich, ohne allzu narzisstisch zu sein, zwischen Diskretion und Offenheit bewegt, ich wollte mit all dem experimentieren. Doch dann ging das nicht mehr: Ich konnte, wollte, durfte nicht mehr so vieles über mein Leben schreiben, weil das Leben sich geändert hatte, plötzlich musste ich mir zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie es ankam, was ich schrieb, ob es möglicherweise verletzte, was ich schrieb (auch wenn es nichts Verfängliches hatte).
Sie merken schon, ich drücke mich schon wieder rum, geht aber nicht anders. Jedenfalls wurde es zu mühsam. Man kann nicht tanzen, wenn man sich dabei ständig fragt, was wohl die Leute denken, die einem dabei zusehen (deswegen kann ich nicht tanzen).
Also hab ich das Weblogschreiben gelassen. Hin und wieder noch einen kleinen Versuch unternommen und dann gleich wieder einschlafen lassen. Es gab ja genug zu tun. Job. Zwei Kinder. Der eigene Bullshit, alles mögliche.
Es hat mir immer wieder gefehlt. So ein kleiner Schmerz, doch dann schüttelt man sich und macht weiter.
Bis der Schmerz und das Fehlen so groß geworden sind, dass ich mich nicht mehr schütteln will.
Also schreibe ich wieder das Weblog. Party like it’s 1999. Mal sehen, wohin ich komme damit. Einen Plan habe ich noch immer nicht. Doch endlich nicht mehr die Vorstellung, dass ich einen haben sollte.
svenk
Le nouveau vague. Willkommen zurück.
fabe
Willkommen zurück & schön, dass Sie wieder da sind!