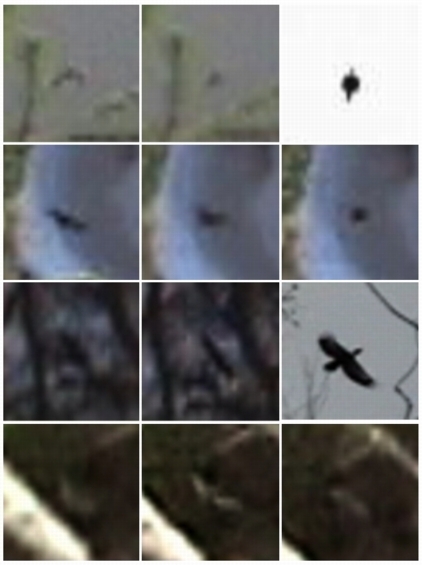31. Als ob sie sich verlören, gäben sie ihn verloren.
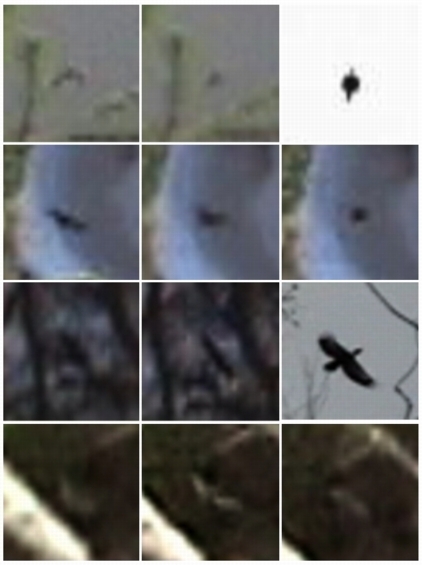
Manchmal wird einer müde. Lassen wir's, sagt er, es hat ja doch keinen Sinn. Wir haben alles versucht. Wir sind im Kayak durch Sümpfe gefahren, wir haben Steckbriefe verteilt, wir haben für verrottende Bäume gesorgt. Wir haben uns auf den Weg gemacht, als Katrina wieder weg war, der Sturm, wussten wir, war ein Geschenk für ihn. Wir haben jede Bewegung am Himmel fotografiert. Wir haben Kameraroboter aufgestellt. Wir haben sogar die NASA dazu gebracht, nach ihm zu suchen. Jedes Mal, wenn einer sagte, es ist vergebens, haben wir Fotos gezückt, auf denen etwas zu sehen war, dass entfernt aussah wie der, nach dem wir suchten. Wir präsentierten Tonbänder. Wir benannten sogar einen Hamburger nach ihm. Aber wenn es ihn wirklich gäbe, hätten wir ihn finden müssen. Wenigstens eine einzige Feder. Aber da war nichts, nie. Es gibt ihn nicht mehr.
Doch immer wenn einer müde ist, sagt ein anderer: Auf keinen Fall. Es muss ihn geben. Niemand kann beweisen, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich bin sicher, es gibt ihn noch.
[Solange sie nach dem Elfenbeinspecht suchen. Solange die Rasenmäher singen. Kann uns nichts passieren. Werden wir nicht frieren. Und alles wird gelingen.]
[Sufjan Stevens: The Lord God Bird (mp3) ]
30. Meine Frau. Das Arschloch.
Ich bin auf den Prenzlauer Berg gezogen. Die Wohnung war gut geschnitten und hatte eine große Küche, die Miete war auf den Quadratmeter umgelegt halb so hoch wie in München und um ein Drittel niedriger als in Hamburg. Eine Woche später fragte einer meiner neuen Kollegen (ich war für einen Arbeitsplatz nach Berlin gezogen), ob ich schon eine Wohnung hätte. Ich sagte ihm, wo. Er sagte: Das ist, wo ihr Arschlöcher alle wohnt.
So deutlich hat es nie wieder jemand gesagt. Dafür habe ich es ein paar Dutzend Mal gelesen. Menschen, die hier wohnen, gelten bei erstaunlich vielen anderen Menschen, die nicht hier wohnen, als so große Arschlöcher, dass die immer wieder darüber schreiben. Ich weiß es, weil ich den Tiraden gelegentlich hinterhergoogle.
Am schlimmsten für die Arschlochhasser sind die Prenzelbergmütter. Sie wissen nicht viel über sie. Sie reden nicht mit ihnen, erkundigen sich nicht nach ihren Leben. Eigentlich wissen sie bloß, dass die Prenzelbergmütter da sind. Auf der Straße, in den Supermärkten, in den Kaffeehäusern. Mit ihren Kinderwägen. Im Kaffeehaus sitzen sie am Nebentisch und packen ihre Euter aus. Im Supermarkt blockiert die Pbergmutter mit ihrem Kinderwagen die Gänge. Auf den Straßen fahren die Pbergmütter die Kinderlosen über den Haufen. Oder ihnen in die Hacken. Mindestens stehen sie im Weg. Man muss ihnen ausweichen. Viel mehr wissen die Arschlochhasser über die Pbergmutter nicht. Vielleicht noch, dass sie ständig Latte Macchiato trinkt. Ihr Kinderwagen ein Luxuskinderwagen ist. Und dass sie Kinderkult betreibt. Mit minimalen Variationen läuft es auf immer dasselbe hinaus: Dass hier Frauen mit Kinderwägen unterwegs sind. Sichtbar.
Die Frau, die ich liebe, mit der ich lebe und mit der ich ein Baby habe, ist so eine Prenzelbergmutter. Ein Arschloch. Sie hat es sich nicht ausgesucht. Die Adresse und das Kind, aber nicht, den Arschlochhassern Anstoß zu sein, aus dem einzigen Grund, dass sie sichtbar ist. Die Arschlochhasser können sie sehen. Wenn sie mit dem Kinderwagen unterwegs ist, mit dem Kind im Kaffeehaus sitzt, mit dem Kinderwagen einkaufen geht.
Sie tut niemandem etwas, sie ist bloß da. An denselben Orten, an denen sich die Arschlochhasser aufhalten. Sie bepöbelt keinen. Sie fährt niemandem in die Hacken. Sie drückt niemandem Kackwindeln in die Hand, keinem ihre Euter in den Blick. Schon weil sie keine Lust darauf hat, dass sich jemand, dem sie es nicht erlaubt hat, Gedanken über ihre Brüste macht. Dass sich jemand Gedanken über den Skandal ihrer Existenz macht, könnte sie nur vermeiden, wenn sie unsichtbar bliebe.
Vermutlich haben die Arschlochhasser nichts gegen die Frau, die ich liebe. Es ist nichts Persönliches. Das Problem der Arschlochhasser ist nicht die einzelne Arschlochprenzelbergmutter. Die verkraften sie. Sondern dass es so viele von ihnen gibt. Man kann nicht zehn Schritte laufen, ohne sie und ihre Luxuskinderwägen, schwarz wie Kindersärge, zu sehen.
Nachts hätten sie Ruhe. Nachts schlafen die Kinder ja, dann merkt man den Frauen nicht mehr an, ob sie Mütter sind. Das Pbergmütterproblem ist ein Tagsüberproblem, zwischen halb acht Uhr morgens und halb acht abends, im Sommer etwas länger. Danach könnten die Arschlochhasser aufatmen. Endlich freie Sicht. Doch das reicht den Arschlochhassern nicht. Der Tag sitzt ihnen in den Nerven. Die ganzen Mütter. Das schlaucht. Wenn es so weitergeht, muss man noch wegziehen. Obwohl. Wie kommen sie dazu? Wieso hauen nicht die Mütter ab? Oder bleiben zu Hause?
Es ist nichts Persönliches. Es geht darum, dass die Arschlochhasser hier einmal zu Hause waren. Oder zu Hause sein hätten können. Jetzt nicht mehr. Weil jetzt so viele Mütter hier sind, die alles majorisieren homogenisieren dominieren. Man fühlt sich wie ein Fremder. Als ob man nicht dazu gehörte. Wenn man kein Kind, keinen Kinderwagen, keinen Kinderwunsch hat. Bevor die Pbergmütter einzogen, war es besser. Es gab so viele Sorten Menschen hier. Alte, Alkis, alte Alkis. Arbeiter. Arbeitslose. Anarchisten. Assis. Und alles andere bis Z. Sogar Mütter. Aber nicht diese. Euter. Kinderwagen mit Kaffeehalter. Verstrahlte Blicke. Sie weichen nicht aus. Man muss um sie herumgehen. Sie besetzen alles. Sie nehmen den Arschlochhassern alles weg.
Die Arschlochkinderarschlochväter kommen in den Tiraden selten vor. Wenn einer mal sein Kind in der Manduca durch die Gegend schaukelt. Oder auf der Marie ins Handy redet, während sein Kind einem anderen die Schippe übern Kopf zieht. Oder am Samstag am Kollwitzmarkt im Weg steht, der Markt war übrigens auch mal anders.
Aber die Arschlochhasser gehen davon aus, dass es einen Arschlochkindarschlochvater gibt. Weil einer die Arschlochkindarschlochmutter finanzieren muss. Die Lilalämpchenwollseidegemischbodies. Die Rasselfischluxuskinderwagenkaffeehalter. Den Kinderkasten vor dem Fahrrad. Und einer muss die Fünfzehnseitenschriftsätze an die Hausverwaltung wegen Lärmbelästigung durch die Kinderlosen schreiben. Die Pbergmutter tut das ja nicht. Sie tut nichts. Außer sich um ihr Kind zu kümmern. Wenn man das mit Kümmern verwechseln will. Auf jeden Fall kümmert sie sich nicht um andere Menschen. Wenn ihr andere Menschen als ihr Kind am Herzen lägen, wäre sie weg. Dann wären die anderen Menschen endlich wieder froh.
Über die Pbergmutter wissen die Arschlochhasser so gut Bescheid wie Sarrazin über Türken, die Flotilla über Israel, die Nazis über die Bilderberger, der Koppverlag über den Fäkaliendschihad: allerbestens. Sie sind da, nicht wahr? Mehr muss man nicht wissen, um zu wissen: Sie müssen weg.
[Neulich schrieb mir über Facebook eine Anja Meier, die ich nicht kannte. Sie lese mit Vergnügen meine "Texte zu Elternschaft im urbanen Raum und in verschiedenen Lebensphasen" (als ob ich solche Texte je geschrieben hätte). Sie würde sich freuen, wenn "gerade" ich über Ihr Buch zu diesem Thema schriebe. Ich sah mir bei Amazon den Waschzettel an und schrieb zurück, ich sei skeptisch, wie jedes Mal, wenn ich Prenzelberg-Bashing und Mittelschichtmutter-Beschimpfe wittere. Weil es mir seltsam vorkommt, wenn ein Stadtteil ein Schurkenstaat sein soll und Mütter, die Gutes für ihre Kinder wollen, suspekt sind. Aber sie könne mir ihr Buch ruhig schicken lassen. Das hat sie letzte Woche veranlasst. Am Wochenende erschien in der taz ein Vorabdruck, die Pbergmütter werden darin Rinder genannt, ihre Brüste Euter. Nicht von Meier, sondern von einer Pberger Kaffeehausbesitzerin. Wenn sie ganz bei sich ist, lässt Meier gerne andere reden. Auch ihre Freundin Sibylle tobt in ihrem Buch viel rum über die Pbergmütter. Obwohl sie auch ihr nichts anderes getan haben, als zu existieren.
Meiers Geschichten, heißt es bei Amazon, seien "vor allem eines: erschreckend wahr, manchmal tragisch - und vor allem urkomisch."
Dass sie tragisch sind, ist nicht gelogen.]